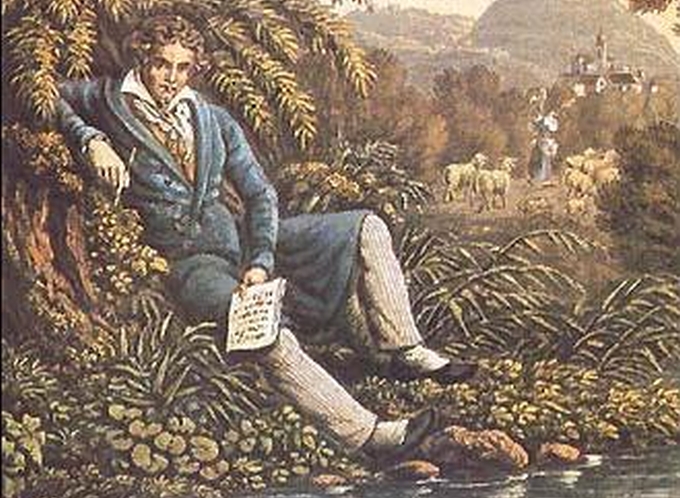Isabelle Faust und das Gewandhausorchester eröffnen im Rahmen des Demokratie-Wochenendes die 245. Saison.
 |
|---|
| Isabelle Faust | © Felix Broede |
Was passiert, wenn aus individueller Klasse kein übergreifendes Ganzes wird, wenn die nötige Motivation fehlt, alles zu geben, das ließ sich im jüngsten Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Slowakei beobachten. Was geschieht, wenn hervorragende Musiker:innen mit höchster Motivation und Freude an der Musik zusammenspielen, konnte das Publikum im Eröffnungskonzert der 245. Gewandhaus-Saison erleben. Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons wirkte so motiviert und gleichzeitig entspannt wie lange nicht mehr und übertrug seine Begeisterung für die Musik auf alle Beteiligten. Jene vielbeschworene „Emotionalität“, die dem DFB-Team offenbar gefehlt hat – hier war sie in jeder Minute greifbar.
Drei Glockenschläge läuten das Konzert ein. Diese ersten Töne der neuen Saison stammen aus Arvo Pärts “Cantus in memoriam Benjamin Britten”, einem kurzen Werk, das exemplarisch zeigt, warum Pärt unter den noch lebenden Komponisten einer der publikumswirksamsten ist. Aus der traditionsreichen Idee des Augmentationskanons gestaltet Pärt eine komplexe und dennoch hörend nachvollziehbare Struktur. Die Streichergruppen setzen nacheinander ein, wobei sukzessive der Tonraum von den höchsten Höhen bis zu den tiefsten Bässen durchmessen wird. Gleichzeitig verdoppeln sich bei jedem Einsatz die Tondauern. Trotz dieses beinahe mathematisch anmutenden Konzepts entfaltet der “Cantus” eine mitreißende Klangwirkung. Nelsons Dirigat ist stringent und klar, sodass auch bei zunehmender Komplexität und Klangfülle stets die polyphone Struktur erkennbar bleibt. Ein gelungener Auftakt!
Die nun folgende Ansprache der Transformationsforscherin Maja Göpel im Rahmen des Demokratie-Wochenendes unter dem Motto “Den richtigen Ton treffen” erinnert ein wenig an politische Sonntagsreden. Außer einigen gut gemeinten Musik-Metaphern dürfte das Publikum aus Göpels äußerst knappen Ausführungen über die aktuelle Bedrohung der Demokratie wohl nur wenig Neues mitnehmen.
Antonín Dvořáks Violinkonzert wird eher selten aufgeführt und tatsächlich zählt es wohl nicht zu seinen besten Werken. Oder? Die heutige Aufführung durch Isabelle Faust und das Gewandhausorchester lässt jedenfalls an diesem Urteil zweifeln. Wenn das Konzert mit solch einer Hingabe musiziert wird, braucht es keinen Vergleich zu scheuen. Oder doch? Egal. Im Hier und Jetzt genieße ich eine musikalische Sternstunde. Fausts körperliches Spiel, das teils beinahe an Tanzen erinnert, und Nelsons sichtbare Freude am gemeinsamen Musizieren entfalten eine Wirkung, der man sich nicht entziehen kann. Der zupackend zackige Beginn des ersten Satzes zeigt sofort, wohin die Reise gehen soll, und tatsächlich bewegt sich diese Aufführung auf konstant hohem Energielevel. Wie sich Nelsons und Faust die Bälle zuspielen und Isabelle Faust immer wieder freudestrahlend Kontakt zum Orchester sucht und findet, ist eine wahre Freude. Ob im gefühlvollen, aber nie schleppenden zweiten Satz oder dem feurigen Finale: Hier ist das Vergnügen aller Beteiligten mit Händen zu greifen. Die beinahe auf ihren Sitzen hüpfende Holzbläsergruppe ist nur ein beliebiges Beispiel für ein Orchester, das lebt und atmet, schwingt und tanzt. Andris Nelsons inspiriert und motiviert, lauscht auf Orchester und Solistin, stampft auch einmal mit dem Fuß auf – mehr Musizierfreude geht nicht. Als Zugabe spielt Faust eine Solo-Fantasie des chronisch unterschätzten Georg Philipp Telemann und gibt dem Publikum damit eine weitere Gelegenheit, ihrem beseelten und wandlungsfähigen Spiel zu lauschen.
Jean Sibelius’ zweite Sinfonie ist vor allem für ihr episches Finale bekannt, bietet aber in jedem Satz aufregende Hörerlebnisse – und ernorme Herausforderungen für das Orchester. Den ersten Satz gestaltet Nelsons dramatisch, ohne seine Schroffheiten zu glätten oder seine Brüche zu kitten. Dies ist wirkungsvoll und spannend, gar keine Frage. Leider reizt Nelsons die dynamischen Möglichkeiten bereits hier fast vollständig aus, sodass er im Finale nicht mehr viel nachlegen kann. Im zweiten Satz gestaltet Nelsons mit dem Orchester einen meisterhaften Spannungsbogen. Dies gelingt vor allem deshalb, weil er stets intensiv auf das Orchester hört und sehr genau darauf reagiert, was das Orchester ihm anbietet. Vollkommenes Pizzicatospiel, strahlendes Blech, virtuoses Paukenspiel – das Gewandhausorchester präsentiert sich zum Saisonauftakt in Bestform. Das Scherzo nimmt Nelsons spannungsgeladen und beinahe atemlos, wobei ihm der Übergang zum letzten Satz leider etwas unklar gerät. Das Finale besticht vor allem durch orchestrale Prachtentfaltung. Die etwa fünfminütige Schlusssteigerung wird zum krönenden Abschluss eines herausragenden Konzertabends. Das begeisterte Publikum belohnt eine technisch beeindruckende, vor allem aber durchweg inspirierte Leistung mit stehenden Ovationen.
Ein gelungener Saisonauftakt, bei dem stets der richtige Ton getroffen wurde!
Wertung:

Frank Sindermann