Das Gewandhaus-Quartett und Bernd Glemser spielen Klavierquintette von Kochan und Brahms.
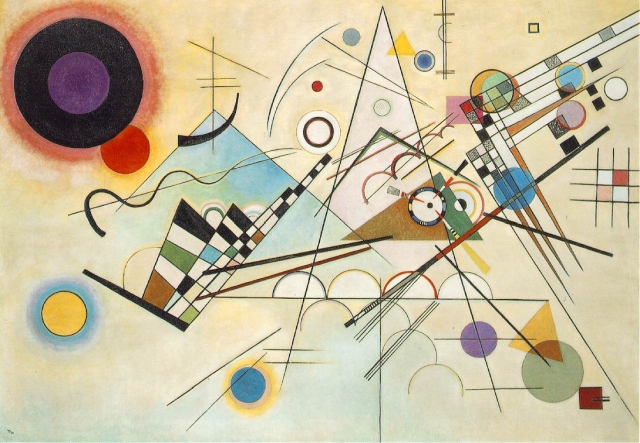
Dass Musik als Kunstform nicht nur eine zeitliche, sondern ebenso eine räumliche Dimension besitzt, ist mir beim Hören von Günter Kochans Klavierquintett in der heutigen Kammermusik-Stunde des Gewandhaus-Quartetts einmal mehr bewusst geworden. Melodische Verläufe und ganz generell durch Metrum und Rhythmus definierte Prozesse spielen in Kochans spätem Gattungsbeitrag nur eine untergeordnete Rolle, das vor allem von ständigen Kontrasten zwischen Enge und Weite, zwischen klanglicher Zusammenballung und Entfaltung geprägt ist.
Das Gewandhaus-Quartett hat das Klavierquintett vor etwa 20 Jahren selbst uraufgeführt und nutzt nun die Gelegenheit, es im Rahmen des „Fokus: 40 Jahre Neues Gewandhaus“ noch einmal ins Programm zu nehmen. Da es zu dem Werk kaum greifbare Informationen gibt – auch das Programmheft liefert nur biografische Notizen zum Komponisten – und auch die Noten nicht leicht greifbar sind, fühlt sich die heutige Aufführung zumindest für mich wie eine spannende Black Box an. Überraschend war sicherlich für einen Großteil des zahlreich anwesenden Publikums allein schon die Kürze der Komposition, deren vier Sätze zusammen keine Viertelstunde dauern. Allzu sehr bedauere ich dies allerdings offen gesagt nicht, denn ungeachtet mancher interessanter Klangeffekte und emotionaler Zuspitzungen finde ich keinen rechten Bezug zu dem Werk; vor allem irritiert mich, wie wenig Streichquartett und Klavier miteinander interagieren, wie viel Potenzial der Besetzung also ungenutzt bleibt.
Johannes Brahms spielt in fast jedem seiner Werke mit der zeitlichen Dimension der Musik. Was schon bei vermeintlich einfachen Kompositionen wie dem Wiegenlied „Guten Abend , gut‘ Nacht“ zu rhythmischen Verschiebungen zwischen Gesang und Klavierbegleitung führt, sorgt beim Hören der Sinfonien oder der Kammermusik bisweilen fast für eine Art metrischer Orientierungslosigkeit. Das Gewandhaus-Quartett und Pianist Bernd Glemser harmonieren bestens miteinander und meistern daher die zahlreichen derartigen Hürden – von einigen Unstimmigkeiten über das Tempo ganz zu Beginn abgesehen – mit bewundernswerter Souveränität. Sie spielen einen klanglich polierten, emotional bewegenden Brahms von geradezu klassischer Ausgewogenheit. Im ersten Satz fehlt es mir etwas an Leidenschaft, das Spiel wirkt streckenweise etwas zu routiniert (man vergleiche die zupackende Einspielung des Quatuor Ébène mit Akiko Yamamoto!), aber dies ist Jammern auf sehr hohem Niveau. Die süße Melancholie des zweiten Satzes wird ebenso überzeugend dargestellt wie das unheimlich glühende Feuer des dritten – und spätestens im Finale geben die Musiker:innen dann auch ihre vornehme Zurückhaltung auf und bringen das Konzert zu einem effektvollen Abschluss.
Frank Sindermann
3. Oktober 2021
Gewandhaus, Mendelssohn-Saal
Gewandhaus-Quartett
Bernd Glemser, Klavier


